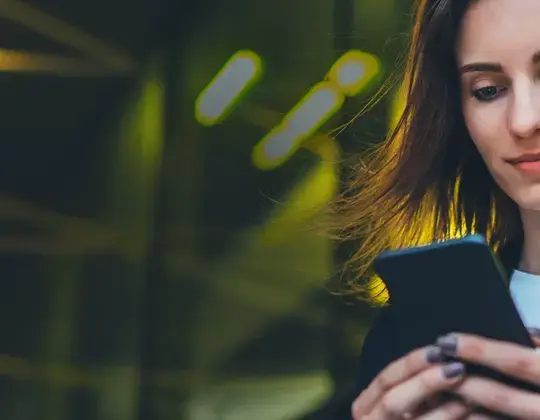am
In diesem Beitrag über Carve-out erfahren Sie,
- was ein Carve-out ist,
- welche Unterschiede es zwischen Spin-off und Carve-out gibt,
- warum sich Unternehmen für einen Carve-out entscheiden,
- wie der Carve-out-Prozess verläuft,
- wie lange ein Carve-out dauert,
- was nach dem Carve-out zu beachten ist,
- welche Herausforderungen ein Carve-out mit sich bringt,
- was einen Carve-out im Mittelstand von dem in Konzernen unterscheidet,
- welche Rolle Interim Professionals bei einem Carve-out spielen,
- was ein Carve-out kostet und
- welche rechtlichen Aspekte bei einem Carve-out wichtig sind.
Carve-out: Definition, Ablauf, Herausforderungen und Erfolgsfaktoren

am
In diesem Beitrag über Carve-out erfahren Sie,
- was ein Carve-out ist,
- welche Unterschiede es zwischen Spin-off und Carve-out gibt,
- warum sich Unternehmen für einen Carve-out entscheiden,
- wie der Carve-out-Prozess verläuft,
- wie lange ein Carve-out dauert,
- was nach dem Carve-out zu beachten ist,
- welche Herausforderungen ein Carve-out mit sich bringt,
- was einen Carve-out im Mittelstand von dem in Konzernen unterscheidet,
- welche Rolle Interim Professionals bei einem Carve-out spielen,
- was ein Carve-out kostet und
- welche rechtlichen Aspekte bei einem Carve-out wichtig sind.
Carve-outs gehören zu den anspruchsvollsten Transformationsprozessen in Unternehmen. Sie sind weit mehr als reine Strukturentscheidungen: Sie verändern Geschäftsmodelle, Organisationen und Unternehmenskulturen – oft dauerhaft. In einer Zeit, in der Geschäftsbereiche regelmäßig neu bewertet, ausgegliedert oder verkauft werden, ist der Carve-out ein zentrales strategisches Instrument geworden. Doch was ist ein Carve-out eigentlich? Was ist der Unterschied zwischen Carve-out und Spin-off? Wie läuft der Carve-out-Prozess ab? Und welche Rolle spielen erfahrene Interim Professionals bei der erfolgreichen Umsetzung?
Was ist ein Carve-out?
Ein Carve-out ist die Ausgliederung eines Unternehmensteils aus einer bestehenden Organisation. Ziel ist es, diesen Teil – das kann eine Tochtergesellschaft, ein Geschäftsbereich oder eine funktionale Einheit wie die IT oder Logistik sein – rechtlich, organisatorisch und operativ vom Mutterunternehmen zu trennen. Häufig erfolgt der Carve-out, um den ausgegliederten Bereich wirtschaftlich besser aufzustellen, ihn auf einen Verkauf vorzubereiten oder für einen späteren Börsengang fit zu machen. In vielen Fällen behält das Mutterunternehmen zunächst eine Beteiligung, um etwa Synergien weiterhin zu nutzen oder den Übergang reibungslos zu gestalten.
Charakteristisch für einen Carve-out ist, dass der ausgegliederte Teil zwar rechtlich selbstständig agiert, jedoch zunächst nicht völlig vom Mutterunternehmen getrennt sein muss. Das unterscheidet den Carve-out von anderen Ausgliederungsformen – insbesondere vom Spin-off.
Was ist der Unterschied zwischen Carve-out und Spin-off?
Wer sich mit strategischen Neuausrichtungen beschäftigt, stößt unweigerlich auf die Frage nach dem Unterschied zwischen Spin-off und Carve-out. Beide Modelle beruhen auf der Idee, einen Teil des Unternehmens auszugliedern – unterscheiden sich aber in Zielsetzung, Umsetzung und rechtlicher Struktur.
- Beim Carve-out steht häufig die wirtschaftliche Verwertung im Vordergrund. Der ausgegliederte Bereich wird in eine eigene rechtliche Einheit überführt, um diese anschließend zu verkaufen, externe Investoren an ihr zu beteiligen oder sie für den Kapitalmarkt vorzubereiten. Die Muttergesellschaft bleibt dabei – zumindest in einer Übergangsphase – oft Gesellschafterin oder Partnerin der neuen Einheit.
- Ein Spin-off hingegen ist eine vollständige und meist dauerhafte Trennung. Dabei entsteht ein neues, eigenständiges Unternehmen, dessen Anteile in der Regel die bisherigen Anteilseignern der Muttergesellschaft halten. Die ursprüngliche Gesellschaft hat anschließend keine direkte Beteiligung mehr. Spin-offs verfolgen damit stärker langfristige strukturelle Ziele, etwa die Stärkung unabhängiger Marken oder die Entflechtung komplexer Unternehmensstrukturen.
Manager gesucht?
Im Matchmaker finden!
und wählen Sie den passenden Begriff aus unserer Vorauswahl.

Warum entscheiden sich Unternehmen für einen Carve-out?
Ein Carve-out ist keine spontane Entscheidung, sondern das Ergebnis strategischer Überlegungen. Unternehmen verfolgen damit üblicherweise folgende Ziele:
- Strukturen verschlanken
- Portfolio optimieren
- neue Wachstumspotenziale erschließen
Fokussierung auf das Kerngeschäft
Häufig sind es veränderte Marktbedingungen, technologische Umbrüche oder interne Entwicklungen, die eine Neuausrichtung notwendig machen. Ein zentraler Beweggrund ist die Fokussierung auf das Kerngeschäft. Wenn Unternehmen in den vergangenen Jahren stark diversifiziert haben, stellt sich irgendwann die Frage, ob alle Geschäftsfelder noch zur strategischen Ausrichtung passen. Bereiche, die nicht mehr im Zentrum der Unternehmensstrategie stehen oder deren Performance hinter den Erwartungen zurückbleibt, werden dann kritisch hinterfragt. Ein Carve-out ermöglicht es, diese Einheiten gezielt auszugliedern, ohne sie abrupt schließen oder verkaufen zu müssen.
Reduktion von Komplexität
Auch in M&A-Kontexten (Mergers and Acquisitions) spielen Carve-outs eine entscheidende Rolle. Unternehmen, die sich auf eine Akquisition vorbereiten, gliedern nicht selten einzelne Bereiche aus, um ihr Profil zu schärfen und/oder unnötige Komplexität zu reduzieren. Umgekehrt sind Carve-outs ein praktikables Instrument, um einzelne Geschäftsbereiche gezielt für einen Verkauf vorzubereiten. Potenzielle Käufer erhalten dadurch ein klar umrissenes Zielobjekt mit eigenständiger Struktur, was die Transaktion deutlich erleichtert.
Kapitalbeschaffung
Darüber hinaus sind Carve-outs ein bewährtes Mittel zur Kapitalbeschaffung. Wird der ausgegliederte Bereich etwa an die Börse gebracht oder an externe Investoren verkauft, fließt frisches Kapital in das Unternehmen. Dies lässt sich nutzen, um Schulden abzubauen, in das verbleibende Kerngeschäft zu investieren oder neue Märkte zu erschließen.
Umsetzung regulatorischer Anforderungen
Nicht zuletzt reagieren Unternehmen mit Carve-outs auch auf regulatorische Anforderungen oder kartellrechtliche Auflagen – etwa im Rahmen von Fusionen oder bei Konflikten mit Compliance-Vorgaben. In solchen Fällen ist der Carve-out nicht nur eine strategische Option, sondern unter Umständen sogar eine Notwendigkeit.
Wie verläuft der Carve-out-Prozess?
Beim Carve-out-Prozess handelt es sich um einen vielschichtigen Vorgang, der weit mehr ist als ein technischer oder buchhalterischer Akt. Mit dem Carve-out-Prozess greifen Unternehmen tief in bestehende Strukturen ein – was eine präzise Planung und professionelle Umsetzung erfordert. Der Erfolg des Carve-outs hängt entscheidend davon ab, ob es gelingt, den ausgegliederten Bereich organisatorisch, rechtlich und operativ eigenständig aufzustellen – ohne das Tagesgeschäft des Mutterunternehmens zu gefährden. Das setzt Erfahrung, Ressourcen und eine stringente Projektsteuerung voraus.
Das sind die verschiedenen Phasen des Carve-out-Prozesses:
1. Phase des Carve-out-Prozesses: Planung
In der Planungsphase des Carve-out-Prozesses analysieren Unternehmen zunächst, welche Einheiten sich zur Ausgliederung eignen und wie die neue Organisation aussehen kann. Hier geht es um grundlegende Fragen:
- Welche rechtliche Struktur ist geeignet?
- Welche operativen Funktionen müssen eigenständig abgebildet werden?
- Welche Abhängigkeiten bestehen zu anderen Unternehmensbereichen?
Diese Vorüberlegungen bilden die Basis für den gesamten Carve-out-Prozess.
2. Phase des Carve-out-Prozesses: strukturelle Vorbereitung
Es folgt die strukturelle Vorbereitung des Carve-out-Prozesses. In dieser Phase geht es primär darum, die organisatorischen und rechtlichen Voraussetzungen für den Carve-out geschaffen. Dazu gehört etwa die Gründung einer neuen Gesellschaft, das Aufsetzen von Verträgen, die Klärung steuerlicher Fragen und die Regelung des geistigen Eigentums. Besonders anspruchsvoll ist in dieser Phase die saubere Trennung der Finanzdaten, IT-Systeme und Personalstrukturen. Hier sind Übergänge oft fließend und mit zahlreichen Schnittstellen verbunden.
3. Phase des Carve-out-Prozesses: operative Umsetzung
Die eigentliche operative Umsetzung des Carve-out-Prozesses beginnt mit dem Aufbau funktionierender Einheiten im Carve-out-Unternehmen. Die neue Organisation benötigt eigene Buchhaltungs-, HR- und IT-Strukturen, ein eigenes Reporting und eine tragfähige Governance. Gleichzeitig gilt es, Mitarbeitende zu informieren, zu begleiten und – wo nötig – in die neue Einheit zu überführen. Kommunikation, Führung und Change Management spielen in dieser Phase eine zentrale Rolle, denn Unsicherheit oder fehlende Orientierung können schnell zu Reibungsverlusten führen.
4. Phase des Carve-out-Prozesses: Post-Carve-out
Nach der rechtlichen und organisatorischen Abspaltung folgt die Post-Carve-out-Phase. Hier geht es darum, die neue Organisation zu stabilisieren, Prozesse zu optimieren und gegebenenfalls auf eine Integration beim Käufer oder einen Börsengang vorzubereiten. Gleichzeitig muss die Muttergesellschaft eventuelle Lücken schließen, etwa in der Supply Chain, im Service oder im Personalbestand. Diese Phase wird häufig unterschätzt – ein Fehler, denn es entscheidet sich gerade hier, ob der Carve-out langfristig wirtschaftlich sein wird.
Der Carve-out ist kein isoliertes Projekt, sondern ein dynamischer Prozess mit zahlreichen Wechselwirkungen. Umso wichtiger ist eine übergreifende Steuerung – idealerweise durch erfahrene externe Spezialisten, die mit der Komplexität solcher Transformationsprozesse vertraut sind.
Wie lange dauert ein Carve-out?
Die Dauer eines Carve-outs lässt sich nicht pauschal festlegen. Sie hängt maßgeblich von der Größe des auszugliedernden Bereichs, der Komplexität der bestehenden Strukturen und der Zielsetzung der Ausgliederung ab. Hier zeigt die Praxis: Ein Carve-out darf kein Schnellschuss sein. Selbst bei guter Vorbereitung dauert der Carve-out-Prozess in der Regel mehrere Monate – in komplexen Fällen auch länger als ein Jahr.
Ein funktionaler Carve-out, bei dem etwa ein einzelner Geschäftsbereich oder ein Teilbereich wie die IT ausgegliedert wird, kann unter günstigen Voraussetzungen innerhalb von sechs bis neun Monaten gelingen. Voraussetzung ist jedoch, dass Prozesse, Systeme und Schnittstellen klar dokumentiert sind und ausreichend interne Ressourcen zur Verfügung stehen.
Anders sieht es bei umfassenderen Vorhaben aus – etwa, wenn es darum geht, internationale Tochtergesellschaften auszugliedern, rechtlich neu zu strukturieren und auf einen Verkauf vorzubereiten. In solchen Fällen sind Projektlaufzeiten von zwölf bis achtzehn Monaten realistisch. Denn neben der eigentlichen Trennung sind hier auch kulturelle, steuerliche und rechtliche Besonderheiten zu berücksichtigen.
Oft unterschätzen Unternehmen zudem den Zeitbedarf für Entscheidungsfindung, Abstimmungen mit dem Betriebsrat, die Implementierung neuer IT-Systeme und die Umstellung der internen Kommunikation. Auch die emotionale Dynamik innerhalb der Belegschaft – ein Carve-out ruft nicht selten Unsicherheit wegen Rollenveränderungen und neuen Berichtslinien hervor – kann Einfluss auf den Zeitrahmen haben.
Unternehmen, die einen Carve-out ins Auge fassen, sollten daher frühzeitig einen belastbaren Projektplan aufstellen und mit realistischen Zeitfenstern arbeiten. Hilfreich ist dabei der Einsatz externer Projektleiter oder Interim Managerinnen, die Erfahrungswerte aus vergleichbaren Vorhaben einbringen und typische Engpässe frühzeitig erkennen. So lassen sich Verzögerungen vermeiden, und der Übergang in die neue Struktur gelingt deutlich effizienter.
Was ist nach dem Carve-out zu beachten?
Ist der Carve-out formal abgeschlossen, beginnt die eigentliche Bewährungsprobe. Denn mit der rechtlichen Trennung allein ist es nicht getan. Jetzt gilt es, die neue Einheit operativ zu stabilisieren, kulturell zu festigen und in ihrer neuen Rolle erfolgreich am Markt zu positionieren. Die Nachbereitungsphase unterschätzen viele Unternehmen. Dies kann fatale Folgen haben, denn diese Phase entscheidet häufig darüber, ob die Ausgliederung langfristig erfolgreich ist. Was also ist nach dem Carve-out zu tun?
Betrieblich-organisatorische Maßnahmen
Nach dem eigentlichen Carve-out stehen zunächst betrieblich-organisatorische Maßnahmen im Vordergrund. Prozesse müssen sich in der Praxis bewähren, neu eingeführte Systeme reibungslos funktionieren und Zuständigkeiten klar verankert sein. Gerade, wenn einzelne Funktionen zuvor zentral gesteuert wurden – etwa im Einkauf, in der IT oder im Personalbereich –, sind nun neue Rollen, Entscheidungswege und Verantwortlichkeiten zu etablieren. Diese Neuaufstellung verlangt von Führungskräften und Mitarbeitenden gleichermaßen eine große Anpassungsfähigkeit und eine hohe Bereitschaft zur Zusammenarbeit.
Positionierung nach innen und außen
Parallel dazu braucht die neue Einheit eine eigene Positionierung nach innen und außen. Nach einem Carve-out stellt sich für Kundschaft, Partnerunternehmen und Investoren oft die Frage: Wofür steht dieses Unternehmen jetzt? Welche Vision verfolgt es? Wie grenzt es sich vom Mutterunternehmen ab? Eine klare Markenidentität und eine gezielte externe Kommunikation mit konsistenten Botschaften sind deshalb essenziell – nicht nur aus Marketingsicht, sondern auch für das Vertrauen der Stakeholder.
Interne Integration
Nicht minder wichtig ist die interne Integration, denn die emotionale Seite des Carve-outs ist nicht zu unterschätzen. Viele Mitarbeitende befinden sich nach einer Ausgliederung in einer Phase der Neuorientierung: Vertraute Strukturen fallen weg, Führungswechsel stehen an, Arbeitsprozesse ändern sich. Um etwaigen Unsicherheiten zu begegnen und die Motivation hochzuhalten, ist es ratsam, transparent zu kommunizieren, das Personal frühzeitige einzubinden und gezieltes Change Management zu betreiben.
Externe Unterstützung
Darüber hinaus ist die neue Organisation häufig auf Unterstützung angewiesen – etwa beim Aufbau fehlender Kompetenzen, der Auswahl geeigneter Systeme oder der Etablierung von Steuerungsmechanismen. Interim Professionals können hier wertvolle Impulse geben: Sie unterstützen pragmatisch beim Übergang, entlasten interne Ressourcen und helfen, die neuen Strukturen zu festigen.
Der Carve-out endet also nicht mit dem Tag der rechtlichen Trennung. Erst, wenn die neue Organisation eigenständig agieren, sich am Markt behaupten und intern stabil arbeiten kann, ist das Ziel der erfolgreichen Ausgliederung wirklich erreicht.
Welche Herausforderungen bringt ein Carve-out mit sich?
Ein Carve-out ist mehr als eine organisatorische Maßnahme. Er ist ein tiefgreifender Umbruch, der alle Ebenen eines Unternehmens betrifft. Gerade, weil bestehende Strukturen aufgebrochen und neu zusammengesetzt werden, entstehen an vielen Stellen Unsicherheiten, Reibungsverluste und kritische Abhängigkeiten. Wer einen Carve-out plant, muss sich bewusst sein: Die Herausforderungen liegen nicht nur in der Planung, sondern vor allem in der Umsetzung. Das sind die zentralen Herausforderungen in der Übersicht:
Trennung von IT- und Prozesslandschaft
Eine der zentralen Herausforderungen ist die Trennung bestehender IT- und Prozesslandschaften. In vielen Unternehmen sind zentrale Systeme – etwa für ERP, CRM, HR oder Finance – über Jahre gewachsen und stark miteinander verknüpft. Diese technischen Infrastrukturen sauber aufzuteilen, ohne den laufenden Betrieb zu gefährden, ist aufwendig. Es sind Schnittstellen anzupassen, Datenbestände zu migrieren und Zugriffsrechte neu zu definieren. Dabei ist höchste Sorgfalt gefragt, denn Fehler oder Verzögerungen in der IT-Trennung wirken sich unmittelbar auf die Geschäftsfähigkeit beider Einheiten aus.
Personelle Neuaufstellung
Eng damit verknüpft ist die personelle Neuaufstellung. Je nach Umfang des Carve-outs sind Unternehmen gefordert, Mitarbeitende neu zuzuordnen, Verträge zu übertragen und Betriebsratsbeteiligungen zu berücksichtigen. Besonders herausfordernd ist der Umgang mit Shared Services – also mit Funktionen, die bislang mehrere Bereiche gleichzeitig bedient haben, wie etwa der Einkauf oder die Buchhaltung. Hier gilt es, Doppelstrukturen zu vermeiden und gleichzeitig sicherzustellen, dass beide Organisationen weiterhin handlungsfähig bleiben.
Interne Kommunikation
Auch auf der kulturellen Ebene bringt ein Carve-out erhebliche Herausforderungen mit sich. Mitarbeitende, die plötzlich zu einem neuen Unternehmen gehören, erleben einen tiefen Einschnitt. Gewohnte Hierarchien, bekannte Kolleginnen und Kollegen sowie vertraute Arbeitsweisen verändern sich – oft radikaler, als zunächst erwartet. Wer in dieser Phase nicht ausreichend kommuniziert, moderiert und begleitet, kann damit Demotivation, Fluktuation oder sogar offenen Widerstände auslösen. Eine gezielte Change-Kommunikation ist daher essenziell, um Vertrauen zu schaffen und Orientierung zu geben.
Operativer Fokus
Zudem besteht die Gefahr, dass der operative Fokus verloren geht. Während sich interne Projektteams intensiv mit der Trennung befassen, müssen das Tagesgeschäft und die Kundenbetreuung reibungslos weiterlaufen. Gerade in vertriebsnahen Bereichen kann dies zu Spannungen führen: Wer kümmert sich um die Pipeline? Wie werden laufende Projekte betreut? Wer trägt Verantwortung, wenn Prozesse stocken? Hier braucht es klare Prioritäten und eine konsequente Doppelsteuerung.
Laufende Kosten
Nicht zuletzt ist ein Carve-out auch finanziell herausfordernd. Die Trennung verursacht nicht nur direkte Kosten für Berater, IT-Anpassungen oder rechtliche Prüfungen, sondern bindet auch intern erhebliche Ressourcen. Die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens hängt davon ab, wie konsequent die Umsetzung erfolgt, und ob es gelingt, geplante Effizienzpotenziale tatsächlich zu heben.
Ein Carve-out ist ein komplexer, risikobehafteter Prozess, der auf vielen Ebenen gleichzeitig wirkt. Ohne erfahrene Führung, klare Kommunikation und externe Unterstützung droht selbst ein gut gemeinter Carve-out zu scheitern – oder deutlich mehr Zeit und Geld zu kosten als geplant.
Was unterscheidet einen Carve-out im Mittelstand von dem in Konzernen?
Ob Mittelstand oder Konzern – ein Carve-out stellt jede Organisation vor komplexe Aufgaben. Doch die Ausgangslage, mit der beide Unternehmensformen in den Carve-out-Prozess starten, ist grundlegend verschieden. Während Konzerne meist über eingespielte Transformationsmechanismen, zentrale Projektmanagement-Teams und etablierte Change-Strukturen verfügen, sind mittelständische Unternehmen oft agiler, aber auch verletzlicher – vor allem im Hinblick auf Ressourcen und Prozesssicherheit.
Carve-out in Konzernen
In Konzernen ist der Carve-out meist Teil einer übergeordneten Strategie. Viele Konzerne haben den Carve-out-Prozess Schritt bereits mehrfach durchlaufen – sei es im Rahmen von Fusionen, Portfoliobereinigungen oder internationalen Reorganisationen. Entsprechend gibt es zumeist standardisierte Vorgehensmodelle, interne Spezialisten und ein dediziertes Projektbüro (PMO), das sich ausschließlich mit der operativen Steuerung des Carve-out-Prozesses befasst. Technologische und juristische Kompetenzen sind konzernintern vorhanden oder lassen sich über bestehende Beratungsnetzwerke zügig einbinden. Diese Professionalität hat jedoch ihren Preis: Entscheidungen dauern länger, Abstimmungen sind komplexer, und Veränderungsprozesse stoßen oft auf politische Interessen.
Carve-out im Mittelstand
Ganz anders die Situation im Mittelstand: Hier ist der Carve-out häufig ein einmaliges Ereignis, welches das Unternehmen stark beansprucht – personell, organisatorisch und emotional. Prozesse sind seltener dokumentiert, Wissen steckt in Köpfen und viele Abläufe sind stark von einzelnen Personen abhängig. Gleichzeitig sind die Wege kürzer, Entscheidungsprozesse weniger formalisiert und die Umsetzungsbereitschaft hoch. Gerade diese Agilität kann ein Vorteil sein – wenn der Carve-out professionell begleitet wird.
Die größte Herausforderung im Mittelstand liegt meist im Mangel an internen Ressourcen. Es fehlen nicht nur Kapazitäten für die Projektarbeit, sondern oft auch methodisches Know-how im Umgang mit IT-Migrationen, rechtlichen Trennungen und steuerlichen Fragestellungen. Häufig gibt es keinen klar definierten „Projektleiter Carve-out“ – die Verantwortung liegt bei der Geschäftsführung selbst oder wird neben dem Tagesgeschäft von wenigen Führungskräften getragen. Das birgt Risiken: Entscheidende Aufgaben bleiben liegen, Meilensteine verschieben sich und wichtige Zusammenhänge werden übersehen.
Gleichzeitig ist die emotionale Dimension eines Carve-outs im Mittelstand besonders ausgeprägt. Mitarbeitende kennen einander, es bestehen gewachsene Beziehungen, Loyalitäten und persönliche Bindungen. Darum erlebt die Belegschaft einen Ausgliederungsprozess wird nicht selten als Einschnitt, der Identität und Zugehörigkeit infrage stellt. Hier braucht es viel Fingerspitzengefühl und eine klare, verlässliche Kommunikation.
Gerade, weil mittelständische Unternehmen in solchen Prozessen oft keine zweite Chance haben, ist die Zusammenarbeit mit erfahrenen Interim Professionals besonders wertvoll. Sie bringen das erforderliche Know-how ein, entlasten die Führungsebene, strukturieren den Prozess und helfen, typische Fehler zu vermeiden. So lässt sich die Agilität des Mittelstands mit der Professionalität eines Konzerns verbinden – eine Kombination, die Carve-outs im Mittelstand besonders erfolgreich macht.
Welche Rolle spielen Interim Professionals bei einem Carve-out?
Carve-outs sind komplexe Projekte mit hoher strategischer Relevanz und engem Zeitrahmen. Sie verlangen nach klarer Führung, fachlicher Tiefe und methodischer Sicherheit – oft unter enormem operativem Druck. Viele Unternehmen stoßen dabei an ihre Grenzen. Nicht, weil ihnen die fachliche Kompetenz fehlt, sondern weil schlichtweg die Kapazitäten nicht ausreichen, um ein solches Transformationsvorhaben zusätzlich zum Tagesgeschäft zu bewältigen. Hier kommen Interim Professionals ins Spiel. Als flexible, erfahrene und hoch spezialisierte Experten begleiten sie den Carve-out nicht nur, sondern sind oft maßgeblich am Erfolg des Carve-out-Prozesses beteiligt.
Die Einsatzmöglichkeiten externer Fachkräfte sind vielfältig. Besonders gefragt sind sie in der Projektsteuerung. Interim Projektleiter übernehmen die Gesamtkoordination, schaffen Strukturen, definieren Meilensteine und sorgen dafür, dass der Carve-out in der vorgesehenen Zeit, im geplanten Budgetrahmen und mit klarer Zielorientierung erfolgt. Sie sind Sparringspartnerinnen für die Geschäftsführung, Moderatoren zwischen den Fachbereichen und Antreiber im Projektalltag.
Auch in den zentralen Unterstützungsfunktionen leisten Interim Professionals einen wertvollen Beitrag. Im Bereich Finanzen etwa kümmern sie sich um die Trennung von Buchhaltungs- und Controlling-Systemen, die Einrichtung neuer Reporting-Strukturen oder die steuerliche Optimierung der Ausgliederung. In der IT sorgen sie für eine saubere Systemmigration, die Definition neuer Benutzerrollen und die Sicherstellung von Datenschutz und Compliance. Im Personalwesen begleiten sie die Überleitung von Arbeitsverhältnissen, entwickeln Kommunikationsstrategien für die Belegschaft und moderieren Verhandlungen mit dem Betriebsrat.
Ein weiterer Vorteil liegt in der Unabhängigkeit externer Expertinnen und Experten. Sie sind nicht Teil bestehender Machtstrukturen, verfolgen keine internen Karriereziele und bringen eine objektive Außensicht mit. Dadurch können sie unbequeme Themen offen ansprechen, Konflikte frühzeitig erkennen und die notwendige Veränderungsbereitschaft einfordern – ohne Rücksicht auf interne Empfindlichkeiten. Hinzu kommt ihre Erfahrung: Wer als Interim Professional Carve-outs in verschiedenen Branchen, Unternehmensgrößen und Konstellationen begleitet hat, erkennt typische Fallstricke schneller, kann bewährte Best Practices einbringen und individuelle Lösungen entwickeln. Dieses Erfahrungswissen ist für Unternehmen von unschätzbarem Wert – gerade dann, wenn intern wenig Routine mit vergleichbaren Veränderungsprozessen besteht.
Interim Professionals bringen genau das mit, was Carve-outs aus einem Mangel oft scheitern lässt – Zeit, Know-how und Umsetzungsstärke. Sie machen Komplexität beherrschbar und schaffen Vertrauen. Zudem stoßen sie den Carve-out-Prozess nicht nur an, sondern führen ihn erfolgreich zum Ende.
Was kostet ein Carve-out?
Die Frage nach den Kosten eines Carve-outs lässt sich nicht pauschal beantworten. Denn die tatsächlichen Aufwände hängen stark von Umfang, Komplexität und Zielsetzung des Projekts ab. Dennoch lässt sich festhalten: Ein Carve-out ist in der Regel mit erheblichen direkten und indirekten Kosten verbunden – gerade dann, wenn er nicht sauber vorbereitet und professionell umgesetzt wird.
Zu den direkten Kosten zählen zunächst die Ausgaben für rechtliche, steuerliche und unternehmerische Beratung. Sobald es darum geht, einen Geschäftsbereich in eine neue rechtliche Einheit zu überführen, sind spezialisierte Juristinnen und Steuerexperten gefragt. Hinzu kommen IT-bezogene Aufwände: Systeme müssen getrennt, Daten migriert, Lizenzen angepasst und neue Infrastrukturen aufgebaut werden. Besonders bei stark integrierten IT-Landschaften ist dies ein kostenintensiver und technischer anspruchsvoller Teil des Projekts.
Ein weiterer großer Kostenblock entsteht durch die interne Bindung von Ressourcen. Weil Mitarbeitende aus Finanzen, HR, IT und Operations üblicherweise in das Projekt eingebunden sind, stehen sie für das Tagesgeschäft nur eingeschränkt zur Verfügung. Dies verursacht verursachen indirekte Kosten durch Effizienzverluste. Wird dies nicht kompensiert, etwa durch den Einsatz externer Unterstützung, gerät nicht nur das Projekt in Verzug, sondern auch das operative Geschäft leidet spürbar.
Hinzu kommen Investitionen in die neue Einheit: Es gilt, neue Führungskräfte müssen zu rekrutieren, Teams aufzubauen und Strukturen zu etablieren. Kommunikation, Schulungen und Change-Maßnahmen verursachen weitere Kosten. Doch solche Maßnahmen sind essenziell, um Akzeptanz zu schaffen und das neue Unternehmen arbeitsfähig zu machen.
Trotz dieser Aufwände ist ein Carve-out nicht zwangsläufig ein Kostenfaktor, sondern kann sich langfristig als wirtschaftlich sehr sinnvoll erweisen. Denn er schafft Transparenz über Kostenstrukturen, macht ineffiziente Prozesse sichtbar und ermöglicht strategische Entscheidungen, die sonst im Konzerngefüge untergegangen wären. Ein gut geplanter Carve-out kann somit nicht nur die Marktposition beider Einheiten stärken, sondern auch echte Wertsteigerung generieren.
Wichtig ist in jedem Fall, frühzeitig eine belastbare Wirtschaftlichkeitsrechnung aufzustellen – mit realistischen Annahmen zu Aufwand, Einsparpotenzialen und mittel- bis langfristigen Erträgen.
Welche rechtlichen Aspekte sind bei einem Carve-out wichtig?
Ein Carve-out ist nicht nur ein betriebswirtschaftliches und organisatorisches Vorhaben, sondern immer auch ein komplexer rechtlicher Prozess. Denn, sobald die Ausgliederung eines Unternehmensteils ansteht, greifen zahlreiche Vorschriften aus dem Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht, Steuerrecht und Datenschutzrecht. Eine saubere rechtliche Strukturierung ist daher unerlässlich – sowohl zur Absicherung der beteiligten Unternehmen als auch zum Schutz der Mitarbeitenden und Geschäftspartner.
Im Zentrum vieler Carve-outs steht die gesellschaftsrechtliche Neuordnung. Dabei stellt sich unter anderem die Frage, welche Rechtsform die neue Einheit erhalten soll – etwa als GmbH, AG oder SE – und wie die Beteiligungsverhältnisse zu gestalten sind. Die Wahl der geeigneten Struktur hat weitreichende Folgen, etwa für steuerliche Pflichten, Governance-Anforderungen und die Kapitalbeschaffung. Hier ist eine enge Abstimmung mit juristischen und steuerlichen Experten unabdingbar.
Ein weiterer zentraler Aspekt betrifft das Arbeitsrecht. In vielen Fällen wechseln Mitarbeitende im Rahmen eines sogenannten Betriebsübergangs nach § 613a BGB von der bisherigen Organisation zur neuen Gesellschaft. Das bedeutet: Die bestehenden Arbeitsverträge bleiben grundsätzlich bestehen, auch wenn der Arbeitgeber wechselt. Arbeitgeberseitige Kündigungen aus diesem Anlass sind nicht zulässig. Gleichzeitig haben die betroffenen Mitarbeitenden ein Widerspruchsrecht, das wiederum zu personellen Lücken im neuen Unternehmen führen kann. Umso wichtiger ist eine frühzeitige, transparente und rechtskonforme Kommunikation – auch gegenüber dem Betriebsrat und weiteren Mitbestimmungsgremien.
Daneben sind zahlreiche vertragliche Themen zu klären. Dazu zählen etwa Dienstleistungsvereinbarungen, Lizenzverträge, Lieferantenbeziehungen und Rahmenverträge mit der Kundschaft. Oft sind Verträge entweder anzupassen, zu übertragen oder neu zu verhandeln. Je nachdem, wie stark der ausgegliederte Bereich mit der bisherigen Organisation verflochten war, kann das erhebliche juristische Aufwände nach sich ziehen.
Nicht zu unterschätzen ist außerdem das Thema Datenschutz. Wenn personenbezogene Daten, etwa von Mitarbeitenden, Kunden und Partnern, in die neue Organisation übergehen, müssen alle Anforderungen der DSGVO erfüllt sein. Das betrifft unter anderem die Einhaltung von Informationspflichten, die rechtmäßige Verarbeitung, die technische Absicherung und den Abschluss geeigneter Verträge zur Auftragsverarbeitung.
Besonders in internationalen Konstellationen – etwa, wenn der Carve-out grenzüberschreitend erfolgt oder Konzerneinheiten in mehreren Jurisdiktionen betroffen sind – steigen die rechtlichen Anforderungen noch einmal erheblich. Unterschiedliche arbeits- und steuerrechtliche Rahmenbedingungen, Währungs- und Bilanzierungsfragen sowie lokale Meldepflichten machen die rechtliche Koordination zu einer anspruchsvollen Aufgabe.
Ein erfolgreicher Carve-out braucht von Anfang an eine fundierte rechtliche Begleitung. Sie bildet das Rückgrat des gesamten Prozesses und schützt Unternehmen vor späteren Risiken, die sich aus Nachlässigkeiten oder rechtlichen Unklarheiten ergeben können.
Carve-outs gelingen – mit klarer Strategie und externer Unterstützung
Ein Carve-out ist ein strategischer Wandel, der tief in die DNA eines Unternehmens eingreift. Wer einen Geschäftsbereich ausgliedert, verändert nicht nur Strukturen, Prozesse und Zuständigkeiten, sondern auch Denkweisen, Verantwortungen und Unternehmensziele. Damit der Carve-out-Prozess gelingt, braucht es Klarheit über das Warum, ein durchdachtes Vorgehen und vor allem die richtigen Menschen an den entscheidenden Stellen. Dabei sind die Herausforderungen vielfältig: Rechtliche Komplexität, technologische Trennung, kulturelle Umbrüche und wirtschaftlicher Druck treffen in einem engen Zeitfenster aufeinander. Wer in einem solchen Szenario ausschließlich auf interne Ressourcen setzt, riskiert Überforderung, Verzögerungen oder strategische Fehlentscheidungen. Gleichzeitig bietet ein Carve-out große Chancen: für Wertsteigerung, Marktprofilierung und organisatorische Weiterentwicklung.
Genau hier zeigt sich der Mehrwert erfahrener Interim Professionals: Sie bringen nicht nur Expertise in Projektsteuerung, IT, Finance, HR oder Change Management mit, sondern auch das Gespür für die Dynamiken eines Transformationsprozesses. Sie arbeiten ergebnisorientiert, unabhängig und lösungsfokussiert – und ergänzen damit ideal die Perspektive des Unternehmens.
Ein gut vorbereiteter und professionell umgesetzter Carve-out stärkt nicht nur die ausgegliederte Einheit, sondern auch die verbliebene Organisation. Er schafft Klarheit über Rollen, Effizienz in den Prozessen und strategische Handlungsfähigkeit. Und er sendet ein Signal – nach innen wie außen: Dieses Unternehmen ist bereit, sich zu verändern, um zukunftsfähig zu bleiben. Wer diese Chance nutzen will, braucht nicht nur Mut, sondern auch Partner, die mit Erfahrung, Klarheit und Umsetzungsstärke an der Seite stehen.
In Ihrem Unternehmen steht ein Carve-out an? Gemeinsam mit Ihnen machen wir uns auf die Suche nach dem passenden Interim Professional für das Ausgliederungs-Projekt. Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf!