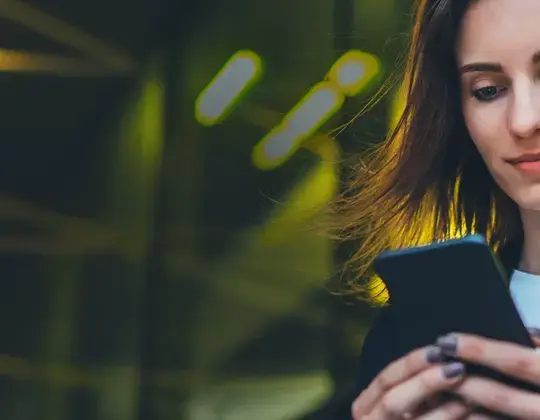In diesem Beitrag Insolvenz in Eigenverantwortung erfahren Sie,
Insolvenz in Eigenverantwortung: Wenn sonst nichts mehr hilft
Es ist das Schreckensszenario im Verlauf einer Unternehmenskrise: Es ist nicht mehr möglich, die Verbindlichkeiten zu bedienen. Eine Firmeninsolvenz ist unausweichlich. Dann geht es laut Insolvenzordnung nur noch darum, das verbliebene Vermögen zu verwerten und den Erlös unter den Gläubigern zu verteilen. So weit, so nachvollziehbar. Doch dass es auch eine andere Option gibt, wissen viele nicht. Gemäß § 1 InsO (Insolvenzordnung) ist es ebenso denkbar, in einem Insolvenzplan eine abweichende Regelung insbesondere zum Erhalt des Unternehmens zu treffen und damit dem redlichen Schuldner eine Gelegenheit zu geben, sich von seinen restlichen Verbindlichkeiten zu befreien. Ganz genau: Es geht um die Insolvenz in Eigenverantwortung.
Was ist eine Insolvenz in Eigenverantwortung?
Eine schwere Unternehmenskrise, die sich mit herkömmlichem Krisenmanagement nicht überwinden lässt, muss nicht zwangsläufig zur Auflösung des Unternehmens führen. Es gibt vielmehr eine gesetzliche Legitimation für den Versuch, das insolvente Unternehmen zunächst zu erhalten: Es bleibt am Markt und erhält die Chance auf einen planmäßigen Turnaround. Bei Sonderregelungen dieser Art handelt es sich im Wesentlichen um einen Teilzahlungsvergleich mit den Insolvenzgläubigern, den die Beteiligten in einem Insolvenzplans fixieren. Um einen solchen Vergleich zu erzielen, müssen die Gläubiger natürlich davon überzeugt sein, dass es wirtschaftlich sinnvoll ist, sich trotz Firmeninsolvenz auf eine Teilzahlung einzulassen. Unter dieser Prämisse lässt sich dann daran arbeiten, die Unternehmenskrise mit einem Insolvenzverfahren ohne externen Insolvenzverwalter zu überwinden. Für eine Insolvenz in Eigenverwaltung braucht es zwar einen Sachwalter, der den Prozess kontrolliert. Doch das eigentliche Insolvenzverfahren bleibt bei der Insolvenz in Eigenverwaltung grundsätzlich in der Hand des Schuldners.
Wann ist eine Insolvenz in Eigenverantwortung sinnvoll?
Sanierungsexperten halten eine Insolvenz in Eigenverwaltung vor allem dann für sinnvoll, wenn es
- aussichtslos ist, die Unternehmenskrise mit klassischen Sanierungsmaßnahmen zu überwinden.
- gelingt, die Gläubiger vom Erhalt des Unternehmens und seines Managements zu überzeugen.
Der Vorteil einer Insolvenz in Eigenverwaltung liegt auf der Hand: Zum einen ist es sinnvoll, auf das vorhandene unternehmerische Know-how, das für ein erfolgreiches Turnaround Management unerlässlich ist, zurückzugreifen. Zum anderen ist eine Insolvenz in Eigenverwaltung erheblich kostengünstiger als klassische Insolvenzverfahren. Denn der Sachwalter erhält nicht einmal zwei Drittel der Regelvergütung eines externen Insolvenzverwalters.
Voraussetzungen für eine Insolvenz in Eigenverwaltung
Grundsätzlich erhält das sich in einer Insolvenzkrise befindende schuldnerische Unternehmen das Recht, unter der Aufsicht eines Sachwalters die Insolvenzmasse zu verwalten und über sie zu verfügen, wenn das Insolvenzgericht die Insolvenz in Eigenverwaltung anordnet. Jedoch müssen hierfür zwei Voraussetzungen erfüllt sein:
- Der Schuldner muss einen entsprechenden Antrag auf die Einleitung einer Insolvenz im Eigenverwaltung-Verfahren gestellt haben.
- Es dürfen keine Umstände bekannt sein, die erwarten lassen, dass die Anordnung zu Nachteilen für die Gläubiger führen könnte.
Um zu entscheiden, ob die zweite Voraussetzung erfüllt ist, hört das Insolvenzgericht den vorläufigen Gläubigerausschuss an. Dieser muss sich einstimmig für die Anordnung einer Insolvenz in Eigenverwaltung aussprechen. Bereits an diesem Punkt des Insolvenzverfahrens müssen die Gläubiger davon überzeugt sein, dass eine Fortführung des Unternehmens gelingen wird und dass die Insolvenz in Eigenverwaltung zu ihrem Vorteil ist. Hierfür ist es unabdingbar, dass die Geschäftsführung geeignete Maßnahmen zur Unternehmenssanierung in die Wege leitet.
Insolvenz in Eigenverwaltung: Ablauf des Verfahrens
Ein Verfahren für die Insolvenz in Eigenverwaltung durchläuft im Wesentlichen vier Phasen: die Antragsstellung, das Eröffnungs- und das Hauptverfahren sowie den Abschluss.
Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung
Zunächst entscheidet das Insolvenzgericht, ob der Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung zulässig ist. Dabei ist nicht nur über die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu entscheiden, sondern auch über den Antrag, die Insolvenz in Eigenverwaltung durchzuführen. Das schuldnerische Unternehmen muss dem Gericht unter anderem ein Verzeichnis der Gläubiger und ihrer Forderungen sowie die Finanzkennzahlen des vergangenen Wirtschaftsjahrs vorlegen. Genaueres ist im ESUG (Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen) nachzulesen.
Im Anschluss an die Stellung des Antrags auf Insolvenz in Eigenverwaltung wird ein vorläufiger Gläubigerausschuss gebildet. Dieser besteht – je nach Unternehmensgröße – aus drei bis fünf Gläubigern und hat den Zweck, die Interessen der Gläubiger zu wahren und eine Benachteiligung einzelner zu verhindern.
Um über den Antrag zu entscheiden, prüft das Insolvenzgericht nicht nur, ob die beiden bereits genannten Voraussetzungen des Verfahrens einer Insolvenz in Eigenverwaltung erfüllt sind, sondern auch, ob eine Eröffnung des Insolvenzverfahrens überhaupt möglich ist. Dafür muss zum einen ein Insolvenzgrund vorliegen, also eine tatsächlich oder voraussichtliche Zahlungsunfähigkeit oder eine Überschuldung. Die Eröffnung des Verfahrens setzt zum anderen den Nachweis voraus, dass die vorhandene Insolvenzmasse zur Deckung der Verfahrenskosten ausreicht. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, eröffnet das Insolvenzgericht das Insolvenzverfahren in der Eigenverwaltung.
Eröffnungsverfahren: Aufbau von Liquidität
Das eigentliche Insolvenzverfahren dient der Befriedigung der Gläubiger. Dazu muss das schuldnerische Unternehmen zunächst wieder Liquidität aufbauen. Genau dafür ist bei der Insolvenz in Eigenverwaltung das dreimonatige Eröffnungsverfahren vorgesehen. Den Krisenmanagern des schuldnerischen Unternehmens stehen dabei verschiedene Instrumente zur Verfügung: Neben akuten Sanierungsmaßnahmen helfen das Insolvenzgeld sowie die Übernahme aller Personalkosten durch die Agentur für Arbeit beim Aufbau der Liquidität.
Hauptverfahren: Befriedigung der Gläubiger
Nachdem das insolvente Unternehmen im Eröffnungsverfahren seine Liquidität zurückerlangt hat, besteht das Ziel des Hauptverfahrens einer Insolvenz in Eigenverwaltung darin, die Gläubiger zu befriedigen. Hierfür müssen sie zunächst ihre Forderungen beim Schuldner anmelden. Um dies allen Gläubigern zu ermöglichen, wird die Insolvenz des schuldnerischen Unternehmens – und damit die existenzbedrohende Unternehmenskrise – öffentlich gemacht. Im nächsten Schritt geht es darum, im Rahmen eines Prüftermins am Insolvenzgerichts die Forderungen der Gläubiger als berechtigt oder als bestritten anerkannt zu ermitteln und dies entsprechend zu vermerken. Dafür ist neben dem Rechtspfleger des zuständigen Insolvenzgerichts der bereits eingesetzte Sachwalter verantwortlich.
Sind alle Forderungen registriert, beginnt das eigentliche Insolvenzverfahren: Die Gläubiger entscheiden in einer Versammlung, wie sich ihre Forderungen am besten bedienen lassen. Zudem muss das schuldnerische Unternehmen Bericht über das Verzeichnis der Massegegenstände, das Gläubigerverzeichnis und die Vermögensübersicht erstatten. Daneben sollte es versuchen, die Gläubiger von der Fortführbarkeit des in der Firmeninsolvenz befindlichen Unternehmens zu überzeugen. Denn die Gläubiger beraten über den Bericht und stimmen über den weiteren Verlauf der Insolvenz in Eigenverwaltung ab. Sollten im Rahmen der Gläubigerversammlung Zweifel am wirtschaftlichen Sinn einer Fortführbarkeit aufkommen, endet die Unternehmenskrise mit einer Liquidierung: Das Unternehmen verschwindet sofort vom Markt, das Vermögen wird veräußert und der Erlös dient zur Befriedigung der Gläubiger.
Halten die Gläubiger eine Fortführung hingegen für sinnvoll, können sie sich gegen oder für die bestehende Geschäftsführung entscheiden. Im ersten Fall kommt es zu einer übertragenden Sanierung, mit der die vorläufige Insolvenz in Eigenverwaltung endet; das Unternehmen wird in Form von Asset Deals verkauft. Im zweiten Fall bestätigt die Gläubigerversammlung die Insolvenz in Eigenverwaltung. Daraufhin ist ein Insolvenzplan aufzustellen, welcher Maßnahmen zur Sanierung des Unternehmens und zur Befriedigung der Gläubiger beinhaltet. Die Feinabstimmung des Insolvenzplans kann recht schwierige Verhandlungen nach sich ziehen. So können bis zu einer endgültigen Bestätigung des Insolvenzplans mehrere Wochen vergehen.
Abschluss der Insolvenz in Eigenverwaltung
Das Verfahren einer Insolvenz in Eigenverwaltung endet mit Annahme des Insolvenzplans. Die Verfahrenskosten werden bezahlt, und die Gläubiger erhalten zumindest einen Teil ihrer Forderungen. Liegt der Schlussbericht vor, kann das Unternehmen nach erfolgter Insolvenz in Eigenverwaltung seinen regulären Betrieb aufnehmen.
Ihr Unternehmen befindet sich inmitten einer schwerwiegenden Krise? Zögern Sie nicht lange und nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir unterstützen Sie umgehend dabei, passende Interim Professionals für eine Insolvenz in Eigenverantwortung zu finden!