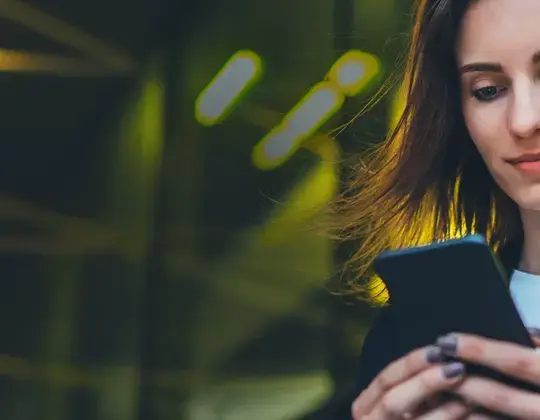am
Digitales Reporting

am
Eine grundsätzliche Auswirkung der Digitalisierung auf das Reporting lässt sich ganz einfach auf den Punkt bringen: Die schiere Menge der Daten erhöht sich exponentiell – und damit die Anforderungen an IT und Controller. Außerdem wächst die Vielfalt der Möglichkeiten im Reporting. Dieser Beitrag stellt einige der Möglichkeiten vor. Zudem finden Sie drei Tipps, mit denen Sie die Einführung mobiler Reportings erfolgreich gestalten.
Reporting 4.0: So verändert die Digitalisierung das Berichtswesen
Big Data ist der Treiber der Veränderung im Reporting 4.0. Die Berichtsinhalte wandeln sich, weil die Zahl der Datenquellen wächst. Gleichzeitig erhöhen sich Quantität und Qualität der Informationen. Daten werden zum Beispiel durch Apps zur Verfügung gestellt, die beim Monitoring von Einkaufs-, Logistik- und Produktionsvorgängen eingesetzt werden. Parallel dazu erheben Unternehmen nicht nur eigene Daten, sondern sie haben auch Zugriff auf Daten von Zulieferern und Kunden. Die Berichterstellung wird durch die Digitalisierung ressourceneffizienter und schneller, weil es möglich ist, Routinetätigkeiten des Reportings weitgehend zu automatisieren.
Digitales Berichtswesen: Die Erwartungen der Nutzer steigen immer weiter
Mit den technischen Möglichkeiten steigen die Erwartungen der Nutzer an die Qualität und den individuellen Zuschnitt der Berichte. Diesbezüglich gilt es künftig, das erweiterte Potenzial praktisch auszuschöpfen. Nutzerorientierung im Reporting bedeutet auch, Informationsüberflutung zu vermeiden und die Berichte an die Anforderungen der Nutzer anzupassen. Das Ziel ist ein nutzergetriebenes Reporting (Pull-Verteilung) – bis hin zum Self Reporting, wenn der Nutzer seinen Bericht über eine geeignete Schnittstelle selbst generiert.
Wichtige Merkmale von Reporting 4.0
Ein funktionierendes Reporting im digitalen Zeitalter liefert Daten:
- aktuell und effizient,
- nach unternehmensweit einheitlichen Standards zur Vergleichbarkeit sowie
- in hoher Qualität und Verlässlichkeit.
Dabei geht ein leistungsstarkes Berichtswesen über die bloße Analyse hinaus. Es entwickelt Prognosen für mögliche Zukunftsszenarien: also Predictive Analysis durch die Auswertung von Big Data. In seiner digital optimierten Form verknüpft das Berichtswesen vorhandene Daten. Es etabliert eine kontinuierliche Governance durch Richtlinien, Standards und Tools der Finanz- und Wertschöpfungsprozesse im Unternehmen und liefert Entscheidungsempfehlungen.
Im Reporting 4.0 leisten automatisierte IT-Prozesse die Hauptarbeit der Datenerhebung und ‑aufbereitung: Daten-Aggregation und Daten-Matching, Datenvisualisierung und Daten-Sharing verlaufen automatisch. Controller greifen in die Analyse ein und übernehmen die führende Rolle in der Kommunikation und Zusammenarbeit mit dem Management. Für die Regeln der Governance und die Definition der Entscheidungswege bleiben weiterhin die Führungskräfte im Controlling verantwortlich. Reporting 4.0 steht für eine Business Intelligence, die die Potenziale von Big Data für eine effektive und qualitativ hochwertige Unternehmenssteuerung nutzt.
Manager gesucht?
Im Matchmaker finden!
und wählen Sie den passenden Begriff aus unserer Vorauswahl.

Drei Tipps für mobiles Reporting: Alle Informationen immer und überall
Zu den neuen Anforderungen an das digitale Berichtswesen zählt, dass Informationen immer und überall verfügbar sein sollen. Bei mobilen Cloud-Applikationen passt sich die Darstellung automatisch an das jeweilige Endgerät an. Im Idealfall beschleunigt mobiles Reporting Entscheidungsprozesse, wenn beispielsweise Finanzvorstände beim Quartalsabschluss auch unterwegs bequem auf wichtige Unternehmensdaten zugreifen können. Das A & O eines solchen erfolgreichen mobilen Reportings liegt in der Usability, also in der Nutzer- oder Anwenderfreundlichkeit.
Tipp 1: Die Prioritäten der Nutzer immer in den Vordergrund stellen
Was die Usability angeht, lassen sich die Wünsche privater Nutzer auf das professionelle Umfeld übertragen. Warum sollte uns der frustfreie Umgang mit Mobilgeräten im Job weniger wichtig sein als in der Freizeit? An diesem Kriterium müssen sich mobile Business-Anwendungen somit messen lassen. Eine Studie des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) identifiziert folgende Nutzerprioritäten für mobile Anwendungen:
- Die Inhalte müssen schnell zur Verfügung stehen.
- Design und Handhabung müssen verständlich und übersichtlich sein.
- Apps müssen über eine fehlerfreie Funktionalität verfügen.
- Die zur Verfügung gestellten Inhalte müssen relevant sein.
- Die Sicherheit der Daten und der digitalen Identität muss gewährleistet sein.
Wenn Mitarbeitende von einer App enttäuscht sind, werden sie damit nicht arbeiten wollen. Wer mobiles Reporting attraktiv machen will, kann somit nur erfolgreich sein, wenn er die Prioritäten der User in das Lastenheft für die App-Entwicklung überträgt und darüber hinaus die Besonderheiten der professionellen Nutzung berücksichtigt.
Tipp 2: Mobiles Reporting nicht mit unnützen Funktionen überfrachten
Schnelligkeit, Verständlichkeit, Relevanz und Sicherheit sind unverzichtbare Voraussetzungen von Apps für das mobile Reporting. Zudem muss der Funktionsumfang eine solchen Anwendung zur Arbeitsrealität passen. Einerseits wollen Menschen mehr als Zahlen und Grafiken, andererseits dürfen die Anwendungen nicht mit unnützen Funktionen überfrachtet sein.
Sinnvoll ist es zum Beispiel, durch einen modularen Aufbau den Detaillierungsgrad der Applikation schrittweise zu erhöhen. Denkbar wäre beispielsweise, dass die ersten Seiten als Übersicht für die Geschäftsführung dienen. Von einem übersichtlich gestalteten Dashboard aus können Nutzerinnen und Nutzer dann auf weitere Seiten mit detaillierteren Informationen für das operative Management der einzelnen Bereiche abspringen. Die zentrale Frage bei der Entwicklung von Dashboard-Seiten muss sein: Wer ist der Empfänger der jeweiligen Seite? Und welche Kerninformationen sind für diese Nutzergruppe sinnvoll?
Die Nutzer schon bei der Planung des mobilen Reportings einbinden
Im Hinblick auf die erfolgreiche Implementierung mobiler Anwendungen empfiehlt es sich, alle verantwortlichen Entscheidungsträger frühzeitig in die Entwicklung einzubinden. Wer Nutzerwünsche erfüllen will, muss mit den Anwendern sprechen. Wichtige Fragen sind beispielsweise:
- Wie erledigen Nutzer der Zielgruppe ihre Reporting-Aufgaben heute?
- In welchen Situationen wollen sie künftig mobil auf Reporting-Daten zugreifen?
- Um welche Daten handelt es sich?
- Wo entstehen Probleme, wo bleiben Wünsche offen?
Folgende Personengruppen können von den Antworten auf diese Fragen und der Entwicklung von Nutzerszenarien profitieren:
- Assistenzen, die nach Meetings Protokolle ins Reporting-System als Referenz eingeben
- Mitarbeitende, die sich in die Kaffee-Ecke zurückziehen, um gemeinsam eine Präsentation vorzubereiten
- Controller, die im Homeoffice an einem Report arbeiten und dazu Live-Daten aus dem Business Warehouse ziehen wollen
- Führungskräfte, die bei einem Kundentermin auf Reporting-Daten Bezug nehmen wollen
In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass zunächst das Management von einer Lösung überzeugt sein muss. Andernfalls bliebe deren Nachhaltigkeit auf der Strecke. Letzten Endes hängt die Akzeptanz des mobilen Reportings von der positiven User-Erfahrung ab. Deswegen gilt der Grundsatz allen guten Designs: Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen.
Im digitalen Reporting werden die Anforderungen an Controller größer und vielfältiger
Die Veränderung der Produktions- und Wertschöpfungsprozesse in der Industrie 4.0 stellt auch das Controlling vor einige zentrale Herausforderungen:
- Es gilt, eine exponentiell größere Datenmenge in Echtzeit auszuwerten.
- Analog zu den Wertschöpfungsprozesse müssen auch die Abläufe im Controlling flexibler sein.
- Die Anzahl der Steuerungsgrößen vergrößert sich erheblich.
- Controllern müssen nicht mehr nur Daten aus der Vergangenheit analysieren. Sie müssen anhand von Daten auch in die Zukunft blicken und valide Vorhersagen erstellen (Predictive Analytics).
Diese Entwicklungen führen dazu, dass die Rolle des Controllers im Unternehmen vielschichtiger und anspruchsvoller wird. Durch die Antizipation von Marktentwicklungen erhöht das Controlling die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Im digitalen Controlling gewonnene Erkenntnisse fließen stärker als zuvor in Produktentwicklung und alle Wertschöpfungsprozesse ein.
Das digitale Controlling 4.0 erfordert neue Controlling-Kompetenzen
Mit diesen Veränderungen im Aufgabenbereich wandeln sich auch die Kompetenzanforderungen an Controller: Auf IT-Ebene geht es nicht mehr in erster Linie um Datengewinnung und Datenbereitstellung. Die Datenanalyse ist integraler Bestandteil aller IT-Prozesse, das heißt: Die Grenze zwischen operativem und analytischem Datenmanagement verschwimmt.
In der Welt von Big Data und des Internet of Things (IoT) sind ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse für Controller unverzichtbar. Neben IT-Wissen und betriebswirtschaftlichem Know-how braucht es ein noch tieferes Verständnis von den Zusammenhängen zwischen Fertigung, Wertschöpfung und Geschäftsmodellen.
ICG-Kompetenzmodell für digitales Controlling
In diesem Zusammenhang hat die International Group of Controlling (ICG) ein Kompetenzmodell für Controller entwickelt. Für das Management der drei Controlling-Kernprozesse – nämlich „Operative Planung/Budgetierung“, „Forecasting“ und „Kosten-/Leistungs-/Ergebnisrechnung“ definiert die ICG als wichtigste Kompetenzen:
- Beratungs-, Organisations-, Kooperations- und Integrationsfähigkeit
- Marktverständnis
- Ganzheitliches Denken und Offenheit für Veränderungen
- Konzeptionsstärke
Unter den Bedingungen der Industrie 4.0 sieht die ICG den Controller auf der strategischen Ebene als Change Agent und beratenden Business-Partner der Führungskräfte. Operativ wird der Controller zum Data Scientist, Analyst und Informationsspezialist. Neben den oben genannten Fähigkeiten liegt daher zusätzlich ein starkes Gewicht auf Kompetenzen wie:
- Business-Wissen
- Fachwissen über Produktionsprozesse
- Fachübergreifende Kenntnisse
- Kommunikationsfähigkeit
- Projektmanagement
Neuausrichtung des Reportings mithilfe von Interim Management erfolgreich gestalten
Neben der Einbindung von Prinzipien der künstlichen Intelligenz bleibt der Mensch und dessen Rolle als qualifizierter Entscheider weiterhin ein zentraler Faktor des Berichtswesens. Die Controlling-Expertinnen und -Experten der Deutschen Interim unterstützen Sie gerne dabei, Ihr Reporting bestmöglich auf die Zukunft vorzubereiten und Prozesse wertschöpfend zu digitalisieren.